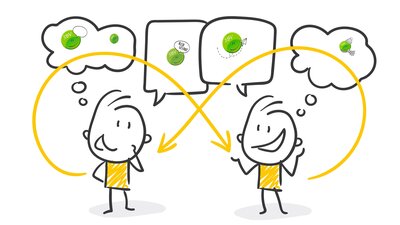Was bedeutet „behindert“, „schwerbehindert“ und „gleichgestellt“?
Den Begriff der Behinderung definiert § 2 SGB IX als:
- Körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen, die in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft
- mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.
- Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.
Durch die Formulierung mit der Inbezugnahme der Wechselwirkung zwischen der Beeinträchtigung und den Umweltfaktoren ist der Behinderungsbegriff an die UN-Behindertenrechtskommission (UN-BRK) angepasst.
Nach dem Wechselwirkungsansatz der UN-BRK manifestiert sich die Behinderung erst durch gestörte oder nicht entwickelte Interaktion zwischen dem Individuum und seiner materiellen und sozialen Umwelt. Dabei stoßen Menschen mit Behinderungen nicht nur auf bauliche und technische Barrieren, sondern auch auf kommunikative Barrieren und andere Vorurteile. Zu den einstellungsbedingten Barrieren gehören vor allem Vorurteile oder Ängste, die Menschen mit Behinderungen beeinträchtigen. Zu den umweltbedingten Barrieren gehören vor allem bauliche Barrieren wie ein barrierefreier Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr und zu öffentlichen und privaten Gebäuden.
Der Hinweis auf die Sinnesbeeinträchtigung führt nicht zu einer Ausdehnung des Behinderungsbegriffs, denn er ist dem Wortlaut der UN-BRK nachgebildet und wurde bereits früher inhaltlich unter das Merkmal der „körperlichen Beeinträchtigung“ eingeordnet. Die Änderung dient nur der Rechtsklarheit.
Der Begriff der Schwerbehinderung wird in § 2 Abs. 2 SGB IX definiert.
- Grad der Behinderung von wenigstens 50
- Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Arbeitsplatz i.S.d. § 156 SGB IX in Deutschland
Die Definition der Gleichstellung wird in § 2 Abs. 3 SGB IX umschrieben.
- Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30,
- Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Arbeitsplatz i.S.d. § 156 SGB IX in Deutschland,
- ohne die Gleichstellung ist ein geeigneter Arbeitsplatz nicht zu erlangen oder nicht zu behalten; dies liegt vor,
- wenn der Behinderte gegenüber Nichtbehinderten auf dem Arbeitsmarkt nicht oder weniger konkurrenzfähig ist bzw.
- mit der Gleichstellung der Arbeitsplatz sicherer wird, da sonst leichter eine Kündigung droht (Beispiele: hohe Krankheitszeiten, krankheitsbedingtes Zuspätkommen etc.)
Wichtig: Die Behinderung muss ursächlich dafür sein, dass der Erhalt des Arbeitsplatzes gefährdet bzw. die Erlangung eines solchen erschwert wird. Wenn beispielsweise ein Arbeitgeber eine gesamte Abteilung schließt, sind alle Arbeitnehmer der Abteilung betroffen, unabhängig von ihrem Grad der Behinderung. In diesem Fall genießen auch gleichgestellte Arbeitnehmer keinen besonderen Schutz.
Wie wird der Grad einer Behinderung festgelegt?
Jeder behinderte Mensch hat einen bestimmten Grad der Behinderung – kurz GdB genannt. Der GdB gibt Auskunft darüber, wie schwer eine Behinderung ist. Er ist ein Maß für die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines Gesundheitsschadens. Dabei bezieht sich der GdB auf die Auswirkung einer Funktionsbeeinträchtigung in allen Lebensbereichen und ist grundsätzlich unabhängig vom ausgeübten oder angestrebten Beruf zu beurteilen. So kann aus der Höhe des GdB nicht auf das Ausmaß der beruflichen Leistungsfähigkeit geschlossen werden.
Wichtig: Die Höhe des GdB sagt nichts darüber aus, ob ein behinderter Mensch für einen bestimmten Arbeitsplatz geeignet oder ungeeignet ist! Je höher der Wert des GdB ist, desto stärker ist eine Person durch ihre Behinderung beeinträchtigt. Der GdB wird, abgestuft nach Zehnergraden, von 20 bis 100 festgestellt.
Ab einem Grad der Behinderung von mindestens 50 gelten Menschen als schwerbehindert. Maßgebend für die Bestimmung des GdB sind „versorgungsmedizinische Grundsätze“. Darin enthalten sind unter anderem Tabellen, in denen bestimmten Behinderungen einzelne GdB-Werte zugewiesen sind. Die dort aufgeführten Werte sind aus langer Erfahrung gewonnen und stellen altersunabhängige Mittelwerte dar. Je nach Einzelfall kann von den vorgegebenen Tabellenwerten mit einer Begründung hinsichtlich der Besonderheiten im jeweiligen Fall abgewichen werden. Diese Grundsätze sind in der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) niedergeschrieben.
Liegen mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vor, so wird ein Gesamt-GdB ermittelt. Dabei dürfen jedoch die einzelnen GdB-Werte nicht addiert werden. Auch andere Rechenmethoden sind für die Bildung eines Gesamt-GdB ungeeignet. Maßgebend sind die Auswirkungen der einzelnen Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinander. So wird beispielsweise geprüft, wieweit die Auswirkungen der einzelnen Beeinträchtigungen voneinander unabhängig sind, sich überschneiden oder sich eine Beeinträchtigung auf eine andere besonders nachhaltig auswirkt. Dabei ist in der Regel von der Funktionsbeeinträchtigung auszugehen, die den höchsten Einzel-GdB bedingt, und dann im Hinblick auf alle weiteren Funktionsbeeinträchtigungen zu prüfen, ob und inwieweit hierdurch das Ausmaß der Behinderung größer wird, ob also wegen der weiteren Funktionsbeeinträchtigungen dem ersten GdB 10 oder 20 oder mehr Punkte hinzuzufügen sind, um der Behinderung insgesamt gerecht zu werden.
Zusätzliche leichte Gesundheitsstörungen, die „nur“ einen GdB von 10 bedingen, führen in der Regel nicht zu einer Zunahme des Ausmaßes der Gesamtbeeinträchtigung. Dies auch dann nicht, wenn mehrere derartige leichte Gesundheitsstörungen nebeneinander bestehen. Auch bei leichten Funktionsbeeinträchtigungen mit einem GdB von 20 wird vielfach nicht auf eine wesentliche Zunahme des Ausmaßes der Behinderung geschlossen.
Wichtig: Bei Anträgen auf Feststellung des Grades der Behinderung soll die Schwerbehindertenvertretung gemäß § 178 Abs. 1 Satz 3 SGB IX den Betroffenen unterstützen.
Wie erfährt die SBV, welche Kollegen schwerbehindert oder gleichgestellt sind?
Eine grundlegende Basis für Ihre Arbeit als Schwerbehindertenvertreter ist das Verzeichnis der schwerbehinderten Menschen. Damit bekommen Sie einen Überblick über den zu betreuenden Personenkreis. Darüber hinaus dient das Verzeichnis als Grundlage für die Liste der Wahlberechtigten bei der SBV-Wahl.
Das Verzeichnis
- müssen alle privaten wie auch öffentlichen Arbeitgeber führen,
- ist gesondert für jeden Betrieb bzw. jede Dienststelle aufzustellen,
- umfasst die beschäftigten schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten behinderten Menschen,
- muss laufend geführt werden und deshalb stets auf dem neuesten Stand sein,
- ist gemäß einheitlichen Vordrucken zu erstellen, die von der Bundesagentur für Arbeit mit den Integrationsämtern vereinbart wurden,
- enthält u.a.: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Beschäftigungszeit, Art der Tätigkeit, Angabe, ob eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung vorliegt und den Grad der Behinderung,
- muss der Arbeitgeber der zuständigen Arbeitsagentur und dem Integrationsamt auf deren Verlangen hin vorlegen. Ist ein Arbeitgeber zur Beschäftigung Schwerbehinderter verpflichtet, muss er das Verzeichnis einmal im Jahr (bis spätestens 31. März des Folgejahres) der zuständigen Arbeitsagentur samt einer Kopie zur Weiterleitung an das Integrationsamt übermitteln, § 163 Abs.1,6 SGB IX.
Führt der Arbeitgeber kein Verzeichnis, führt er es nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise oder legt er es den Behörden nicht rechtzeitig vor, dann handelt er ordnungswidrig. Dies kann ein Bußgeld zur Folge haben (§ 238 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX).
Wichtig: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Kopie des Verzeichnisses sowohl der Schwerbehindertenvertretung als auch dem Betriebs- bzw. Personalrat und dem Inklusionsbeauftragten zuzusenden. Denn sie alle haben gemäß ihrer gesetzlichen Aufgabe, die Einhaltung der Verpflichtungen des Arbeitgebers zugunsten schwerbehinderter Menschen gemäß § 163 Abs. 2 SGB IX zu überwachen. Verweigert der Arbeitgeber die Übermittlung einer Kopie des Verzeichnisses, kann diese von der Schwerbehindertenvertretung vor dem Arbeitsgericht einklagt werden.